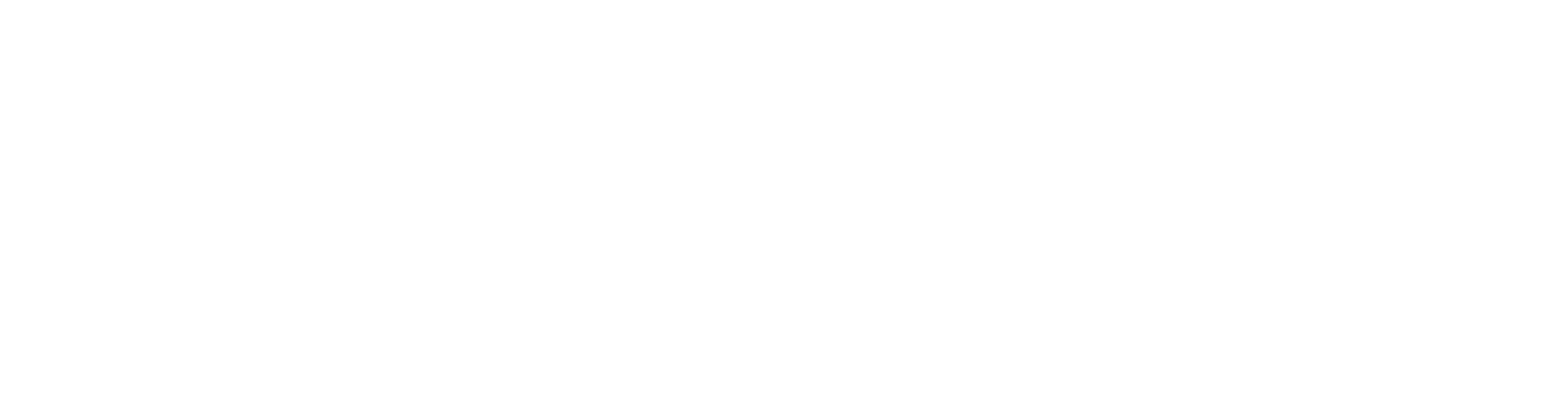Gewalt in Kriegen
Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe
Verfolgungen, Ermordungen und Folter – all das lässt sich täglich in jedem bewaffneten Konflikt wiederfinden. Aber nicht nur diese Gewaltformen werden in Kriegen präsent. Die sogenannte “sexualisierte Gewalt” ist auch Teil davon, und wird als “Waffe” stetig eingesetzt.
Sexualisierte Gewalt ist nicht nur ein Kriegsphänomen. Sie passiert jeden Tag und ist Alltag von vielen Frauen weltweit. Trotzdem lässt sich beobachten: Zu Kriegszeiten nimmt diese Gewalt nochmal eine andere Dimension an. Ob im 2. Weltkrieg, Vietnamkrieg, Afghanistan-USA-Konflikt oder im aktuellen Russland-Ukraine-Krieg: Sexualisierte Gewalt wurde schon immer in jeglichen militärischen Auseinandersetzungen angewendeten. Diese Art von Gewalt kann viele verschiedene Formen annehmen. Darunter zählen Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, erzwungenes Auskleiden oder körperliche Belästigung, zum Beispiel unerwünschtes Anfassen vom eigenen Körper. Auch sexuelle Versklavung oder Zwangsprostitution können Teile dieser Gewalt sein. Laut Schätzungen sind in Kriegen meist zwischen 20.000 und 250.000 Personen von sexualisierter Gewalt betroffen. Die Zahl der betroffenen Personen des zweiten Weltkrieges wird sogar auf knapp 900.000 geschätzt.
Die Täter
Ausgeübt werden diese Taten meistens von männlichen Tätern. Die können aus allen möglichen Berufen und Schichten stammen. Oft sind es Soldaten. Manchmal sind es sogar Personen, denen man solche Grausamkeiten nicht zutraut: Polizisten zum Beispiel, oder sogar Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, auf die die Betroffenen angewiesen sind. Dieses Machtgefälle wird dann von den Tätern ausgenutzt.
Die individuellen Motive der Täter
Es kann viele unterschiedliche Motive haben, die die Täter solcher Gewaltausübungen damit verfolgen. Wenn beispielsweise ein Soldat des einen Landes eine Frau des gegnerischen Landes vergewaltigt, ist das Ziel häufig ganz klar: sie wollen die gegnerische Bevölkerungsgruppe zerstören, traumatisieren und im schlimmsten Fall komplett auslöschen. Die betroffenen Personen tragen so oft extreme körperliche und psychische Schäden davon. Das kann beispielsweise dazu führen, dass sie später keine Kinder kriegen werden. Im schlimmsten Fall führt es zum Suizid. Nicht nur die Opfer selbst, auch die Angehörigen können eine extreme Traumatisierung erleben, die sie ein Leben lang mit sich herumtragen. Einigen geht es einfach um die Macht: sie möchten ihre Macht zeigen, sie demonstrieren. Und das tun die Täter, in dem sie anderen, hilf- und schutzlosen Personen Gewalt antun. Auch internalisierter Frauenhass, der in einigen stark patriarchalen Gesellschaften und Familien als normal angesehen wird, kann ein Motiv für sexualisierte Gewalt sein. Um den Sex selbst geht es bei solchen Taten eigentlich nie.
Warum gibt es sexualisierte Gewalt?
Die Gründe für sexualisierte Gewalt sind sehr komplex und lassen sich nicht auf einen einzigen Grund runterbrechen. Es gibt aber verschiedene Aspekte, auf die diese Gewalt zurückzuführen sein könnte. Helena Haack ist Sprecherin der Frauenrechts – und Hilfsorganisation “Medica Mondiale”. Sie setzen sich für Frauen ein, die von sexualisierter Kriegsgewalt betroffen sind. Sie sieht unter anderem das Aufwachsen der Täter in patriarchalen Strukturen als möglichen Grund für die Gewalt.
“Jeder Soldat war, bevor er zur Armee gegangen ist ein Kind, das in einem System aufgewachsen ist, in dem sie gesehen haben, wie Frauen abgewertet und diskriminiert werden und weniger wert seien. Und in dem Moment, in dem sie eine Waffe in die Hand bekommen, leben sie diese Macht dann auch auf den Körpern von Frauen aus.“
Helena Haack
Viele Täter sind also genau mit solchen Werten aufgewachsen: Frauen sind weniger wert, Frauen sind Eigentum. Besonders in Kriegssituationen sehen sie dann die Möglichkeit, diese Ansichten und Werte durch Gewalt auszuüben, denn: Die Täter bleiben meist unbestraft. DasS sie ohne Strafe davonkommen, wird ihnen auch von Vorherein klargemacht:
“Sexualisierte Kriegsgewalt als Waffe ist sehr schwer nachzuweisen. Häufig ist es so, dass Vorgesetzte eine Atmosphäre schaffen, in der sich Soldaten sicherfühlen. Das passiert dann oft über Codewörter oder “Witze”, die gemacht werden. Das heißt, ein Vorgesetzter kann damit rechnen, dass seine Soldaten bei Gelegenheit vergewaltigen werden. Er kann das einplanen.“
Helena Haack
Einige Täter werden also, wenn nur indirekt, zu solchen Gewalttaten aufgerufen. Diese Aufrufe im Nachhinein nachvollziehen zu können, ist fast unmöglich. Sie gehen davon aus, nicht bestraft zu werden, was auch meistens der Fall ist.
Oft spielt auch extremer Patriotismus dabei eine Rolle. Viele Soldaten kämpfen beispielsweise mit der festen Überzeugung, sich zu jedem Preis für ihr eigenes Land einzusetzen. Wenn dann Mitgefühl für “gegnerische Personen” ins Spiel kommt, kann das als Verrat an das eigene Vaterland angesehen werden.
Folgen für betroffene Personen
Sexualisierte Gewalt zu erleben, kann die Überlebenden extrem traumatisieren. Viele tragen psychische Schäden davon, die sie ein Leben lang begleiten. Viele Betroffene haben auch mit Stigmatisierung zu kämpfen: Sie werden im Stich gelassen von der Familie, verlieren ihre Ehepartner:innen, werden von der Gesellschaft ausgeschlossen. Aber nicht nur die Opfer sexualisierter Gewalt tragen Traumata davon.
Sexuelle Gewalt traumatisiert und zerstört ganze Gemeinschaften und Familien für Generationen, sie verändert die Bevölkerungsstruktur des Gebiets.
Sofi Oksanen, Autorin von “Putins Krieg gegen die Frauen”
Sofi Oksanen spricht in ihren Buch unter anderem darüber, inwiefern sich das Erleben von sexualisierter Gewalt auf die nächsten Generationen auswirken kann. Für diese generationenübergreifende Traumatisierung gibt es laut Helena Haack auch einen Begriff: “Transgenerationales Trauma”.
“Das heißt, dass eine Frau, die im Krieg vergewaltigt wurde, oft auch unbewusst das erlebte Trauma, über das sie vielleicht nie gesprochen hat, an ihre Kinder weitergibt […] Die Kindergeneration erlebt dann Trauma-Erscheinungen, obwohl sie die ursprüngliche Gewalt gar nicht erlebt haben.”
Helena Haack
Der Umgang mit dem Thema
Das über sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe überhaupt gesprochen wird, ist noch nicht lange der Fall. Lange wurde das Thema ignoriert und totgeschwiegen. Viele Überlebende hatten oft nicht die Kraft oder den Mut, darüber zu sprechen. Das liegt unter anderem daran, dass Personen, die über die Taten sprechen, dafür sogar bestraft wurden. Das war beispielsweise in Russland der Fall. Sofi Oksanen sagt in ihrem Buch:
“Die Opfer, die nicht schweigen, […] werden zu Verbrechern abgestempelt. […] Es ist ein Verbrechen ohne Bestrafung und eine Bestrafung ohne Verbrechen.”
Sofi Oksanen
Den Tätern wird außerdem sehr selten nachgegangen. Das Thema wird bagatellisiert. “Es wurde oft von einem Kollateralschaden gesprochen. Nach dem Motto: „Das ist ein Krieg, und das gehört nun mal dazu“”, sagt Helena Haack im Interview. Die Verantwortung wird den Tätern also oft abgesprochen, und keiner wird zur Rechenschaft gezogen.
Trotzdem hat sich im Umgang mit sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe etwas geändert. Im Jahr 2000 wurde vom UN-Sicherheitsrat die Resolution “1325” mit der Agenda “Frauen, Frieden und Sicherheit” verabschiedet. Diese Resolution soll unter anderem die Sicherheit von Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten fördern. Im Jahr 2008 stufte der UN-Sicherheitsrat Vergewaltigungen und andere Arten sexualisierter Gewalt offiziell als Kriegsverbrechen ein.
Diese Resolutionen waren Schritte in die richtige Richtung, aber dennoch nicht ausreichend. Auch bei aktuellen Kriegen sehen wir: Sexualisierte Gewalt ist noch immer präsent. Und das muss sich ändern.