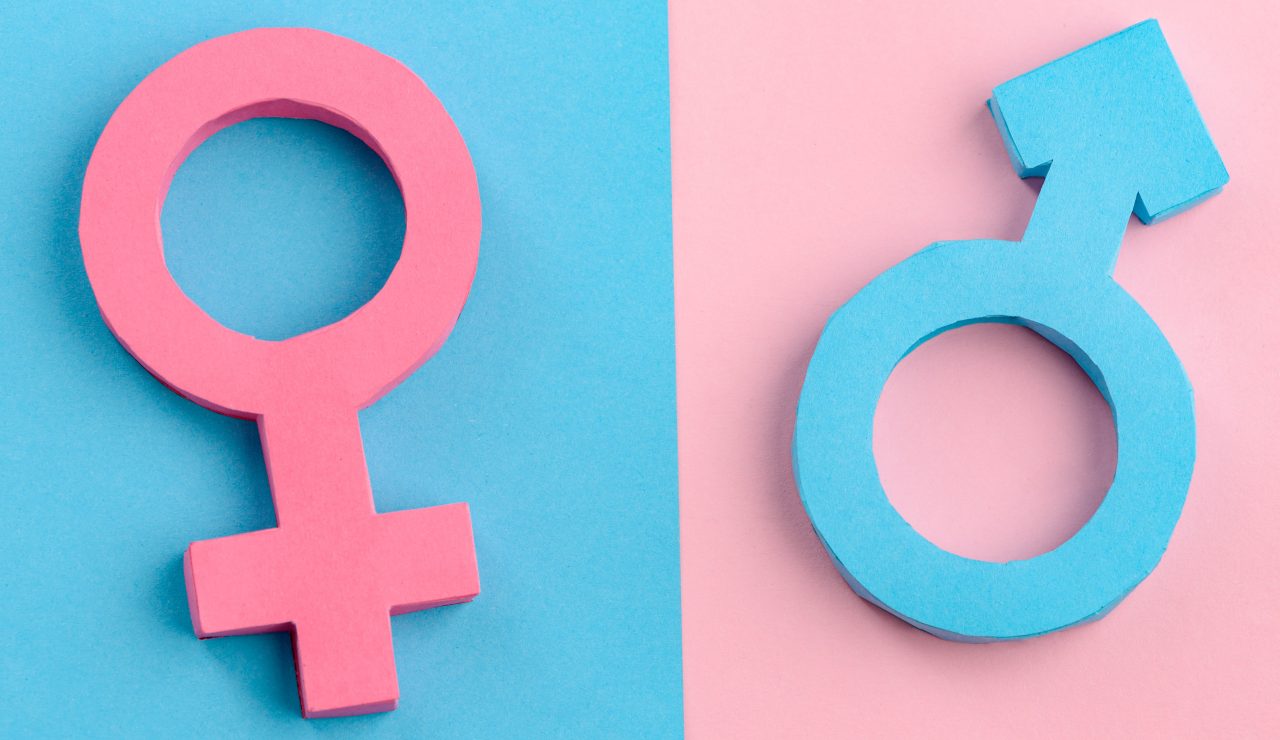
Der Einfluss auf unsere Persönlichkeit
Geschlechtsspezifische Sozialisation
Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.
Simone de Beauvoir
Männer seien rational – Frauen emotional. Männer seien durchsetzungsstark und ehrgeizig – Frauen sensibel und empathisch. Diese Aufteilung in “männertypische” und “frauentypische” Eigenschaften ist Teil unserer Gesellschaft. Sie sorgt dafür, dass wir Menschen nur anhand ihres biologischen Geschlechts bestimmte Charakterzüge zuordnen. Oft, ohne sie überhaupt zu kennen. Dabei ist es nicht das Vorhandensein eines XY- oder zweier X-Chromosomen, die uns diese Merkmale verleihen. Wir werden nicht so geboren – wir werden dazu gemacht. Und zwar durch die “geschlechtsspezifische Sozialisation”. Das bedeutet, das Frauen und Männer schon seit ihrer Kindheit auf eine bestimmte Art und Weise erzogen, geprägt und somit sozialisiert werden. Und diese Sozialisation sorgt dafür, dass wir bestimmte Verhaltensweisen annehmen, unabhängig von dem, was uns biologisch “weiblich” oder “männlich” macht.
Sozialisation in der Kindheit
Diese Sozialisation beginnt schon sehr früh. Als typisches “Mädchenspielzeug” beispielsweise gelten Puppen und Kinderwägen: Ihnen wird also früh beigebracht, die Rolle der “Hausfrau und Pflegerin” anzunehmen. Mädchen werden außerdem öfter als Unterstützung in den Haushalt mit eingebunden, Jungen seltener. Generell wird biologisch weiblichen Kindern weniger zugemutet – sie werden von früh an, wenn auch unbewusst, als das “schwächere Geschlecht” dargestellt und sozialisiert: “Ich brauche mal einen starken Jungen zum Stühle holen”, bekommen Schüler:innen häufig zu hören. “Du bist ja total langsam gerannt, du rennst wie ein Mädchen” – solche Sätze verbinden das weibliche Geschlecht mit Eigenschaften wie Schwäche und geringer Leistungsfähigkeit. Das kann dazu führen, dass weibliche Personen sich früh weniger zutrauen als männlichen Personen. Dadurch nehmen Männer eher die Eigenschaft von zum Beispiel Durchsetzungsfähigkeit an.
“Nature vs. Nurture”
Nature vs. Nurture beschreibt das Zusammenspiel von Biologie und den Umwelteinflüssen, die uns in der Entwicklung prägen. Bei der geschlechtsspezifischen Sozialisation gibt es dieses Zusammenspiel auch: Ein “rein männliches” oder “rein weibliches” Gehirn gibt es als solches nicht. Sie unterscheiden sich höchstens in ihrer Größe und Schwere.

Allerdings gibt es Studien, die zeigen, dass bei Frauen oft andere Teile im Gehirn bei bestimmten Emotionen aktiv sind als bei Männern. So zeigt es auch eine Studie der Universidad Nacional Autonoma de Mexico: Bei einem Experiment wurden männlichen und weiblichen Teilnehmer:innen Bilder gezeigt, die Mitgefühl auslösen sollten. Bei Frauen wird bei dem Gefühl von Empathie auch tatsächlich das Zentrum im Gehirn aktiv, in dem solche Empfindungen verarbeitet werden. Bei den männlichen Teilnehmern wurden die Teile des Gehirns aktiv, die für die Analyse und Beobachtung der Umwelt zuständig sind. Bei ihnen war das Gefühl der Empathie also ein Resultat einer rationalen Umweltanalyse.
Mögliche Erklärungen der Ergebnisse
Die Beobachtungen lassen sich vermutlich auf die lebenslange Sozialisation zurückführen: Das Umfeld und die Gesellschaft spielen nämlich eine wichtige Rolle bei der Ausbildung unserer Emotionen und Reaktionen. Männer werden meistens als die “starken Familienernährer und Beschützer” sozialisiert, während Frauen in die Rolle der “Care-Arbeiterinnen und Pflegerinnen” gedrängt werden. Dadurch kann es sein, dass Frauen deutlich vielschichtigere Mechanismen bei Emotionen, wie dem Mitgefühl entwickelt haben. Also könnte an dem Geschlechterklischee, das Frauen prinzipiell empathischer und mitfühlender als Männer seien, durchaus etwas dran sein – das hat dann aber nichts damit zu tun, ob wir mit zwei X – oder mit einem X und einem Y-Chromosom geboren werden. Diese Eigenschaften sind zurückzuführen auf unsere Sozialisation der Gesellschaft, in der Frauen nun mal diese Eigenschaften beigebracht werden. Biologie und unser Umfeld gehen also Hand in Hand.
Mentale Folgen von geschlechtsspezifischer Sozialisation
Geschlechtsspezifische Sozialisation kann einen großen und meist negativen Einfluss darauf haben, wie wir uns selbst als Individuum sehen und einschätzen. Ein gängiges, internalisiertes Klischee ist, Frauen seien deutlich schlechter in Naturwissenschaften als Männer. Viele Schülerinnen wachsen dann mit diesem Klischee auf, und werden beispielsweise durch Eltern und Lehrer:innen so sozialisiert. Das führt dazu, dass sie sich selbst und ihre Fähigkeiten unterschätzen, sodass sie tatsächlich in Tests schlechter abschneiden.
Auch für männliche Personen ist geschlechtsspezifische Sozialisation nicht vorteilhaft: Das Gefühl, dauerhaft Stärke zeigen zu müssen und ja nicht verletzlich sein zu dürfen führt zum Beispiel dazu, dass sich viele männlich sozialisierte Personen zu spät Hilfe holen bei körperlichen oder auch psychischen Problemen. Die Sozialisierung von männlichen Personen ist auch ein Grund dafür, dass Männer im Schnitt fünf Jahre früher sterben als Frauen. Das liegt unter anderem an der deutlich höheren Risikobereitschaft der Männer. Ihr Lebensstil ist dadurch oft ungesünder, sie rauchen und trinken mehr. Wenn sie dadurch gesundheitliche Probleme bekommen, gehen sie meist zu spät zum Arzt um sich die nötige medizinische Hilfe zu holen. Dasselbe gilt für mentale Probleme. In der Angst, “schwach” und “unmännlich” zu gelten, ziehen sie meistens keine oder zu spät professionelle Unterstützung in Erwägung. Die geschlechtsspezifische Sozialisation führt also auch zu einer höheren Suizidrate von männlichen Personen.
Generell gesehen gibt es keine angeborenen “typisch männlichen” und “typisch weiblichen” Eigenschaften. Alles, wofür Frauen und Männer klischeehaft stehen sollen, ist auf die Sozialisation zurückzuführen, die sowohl weibliche als auch männliche Personen nur in stereotypische Rollenbilder drängt. Wie Simone De Beauvoir schon sagte: “Man wird nicht als Frau geboren, man wird es.”



